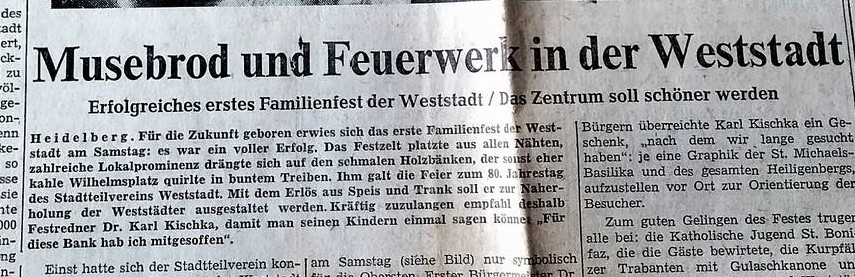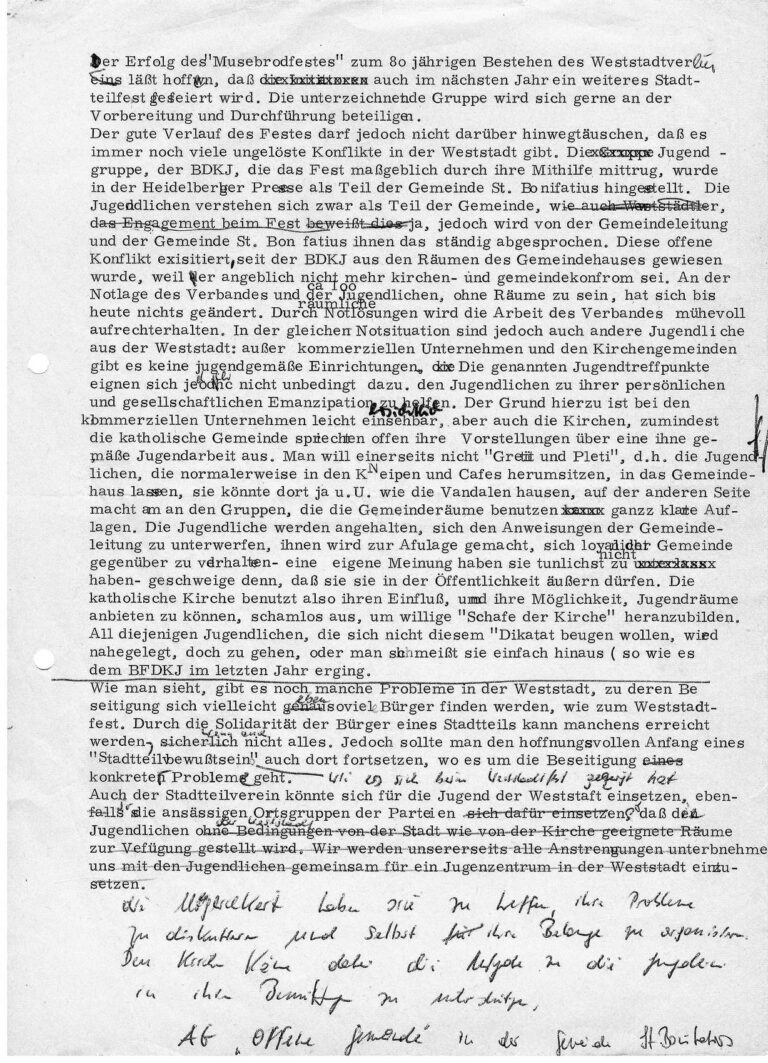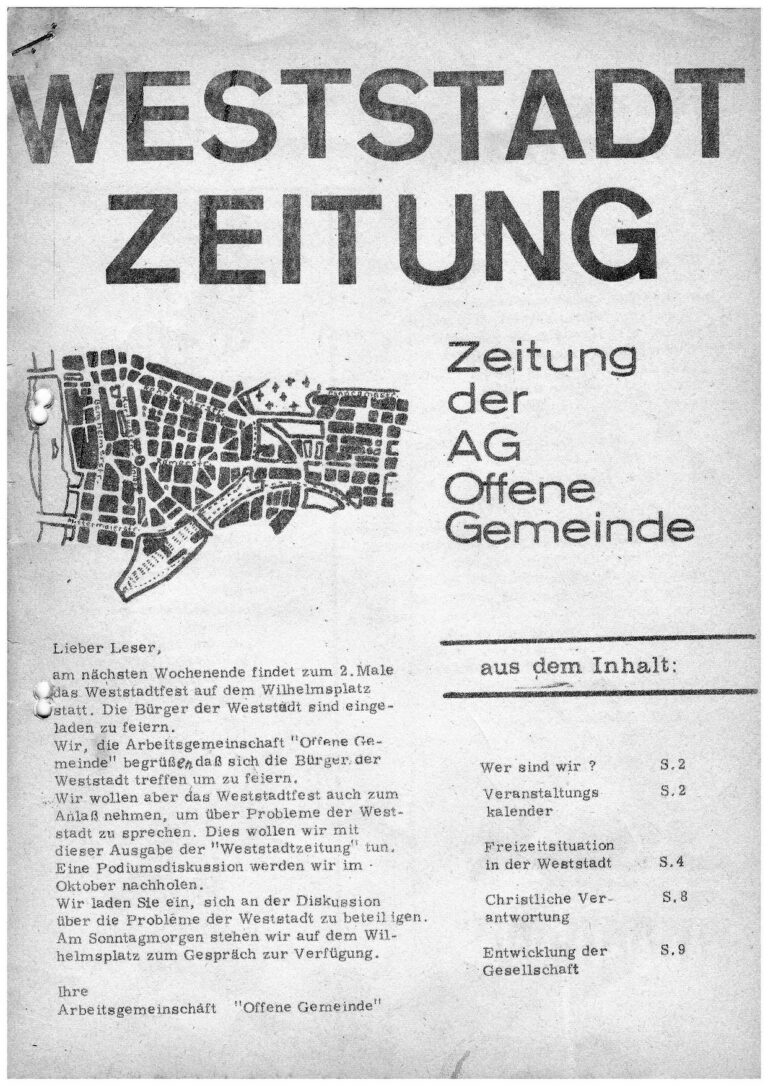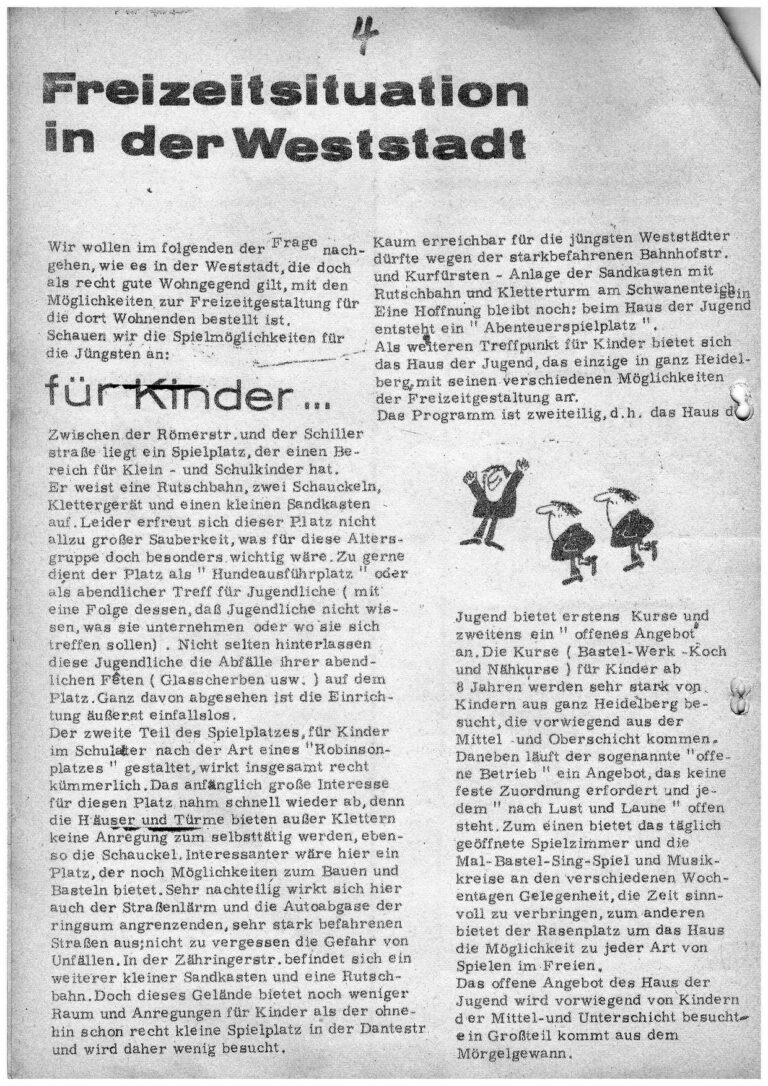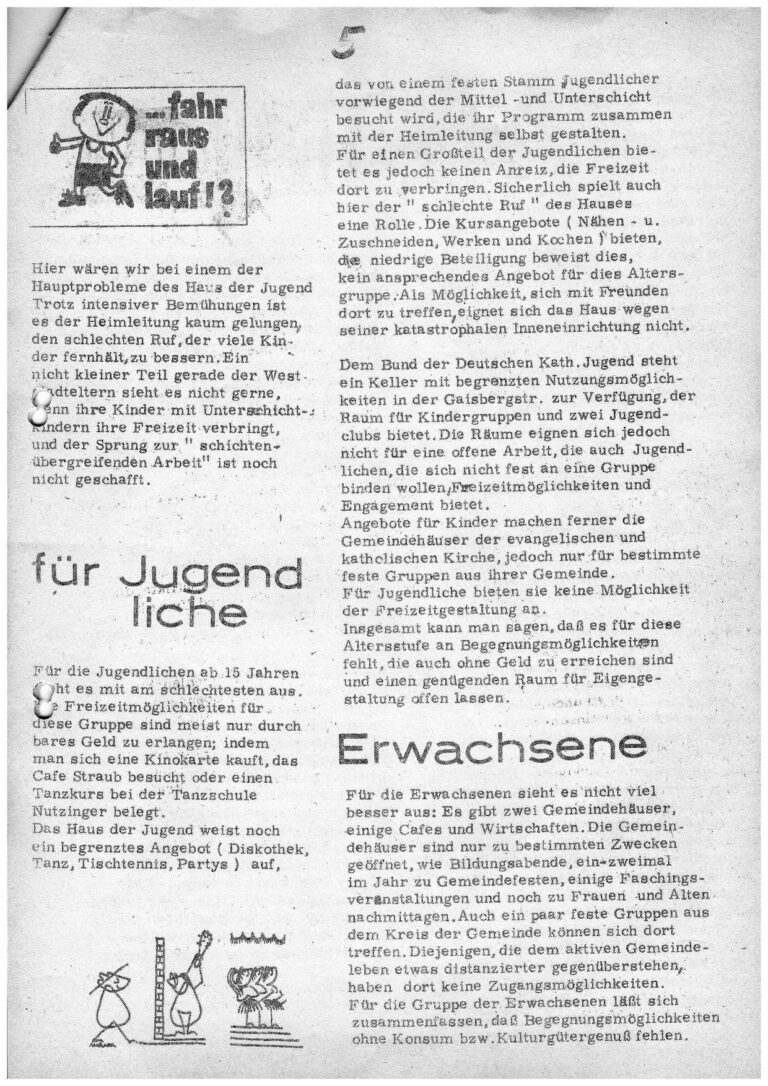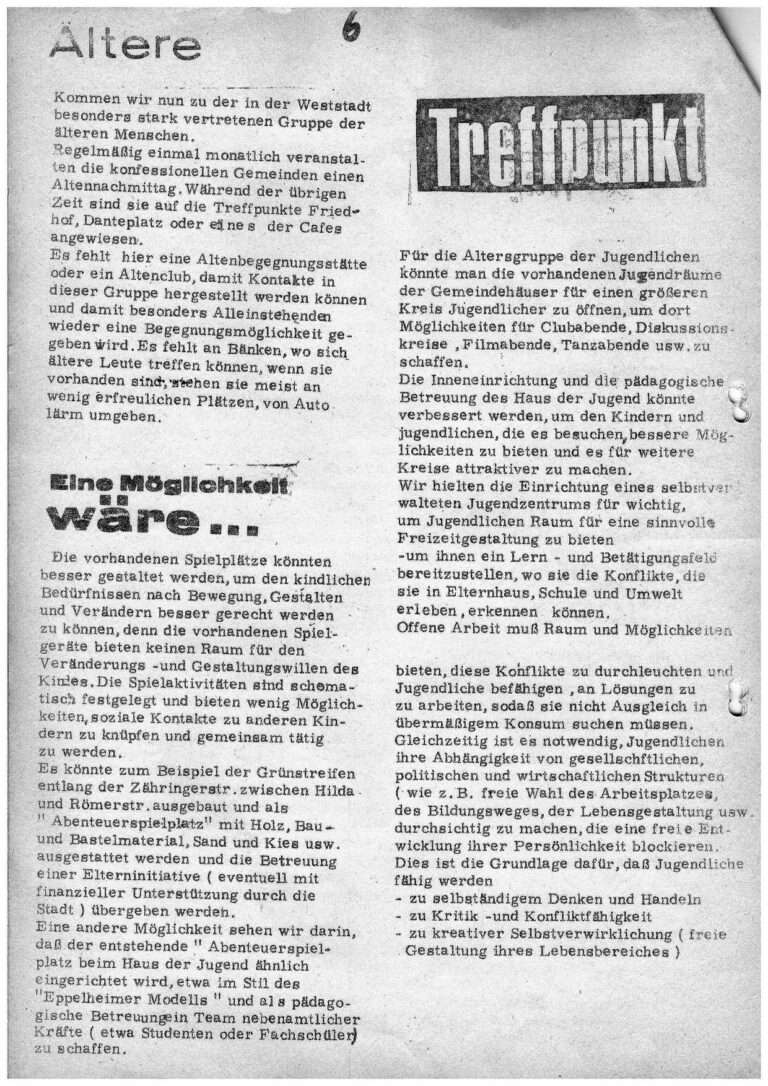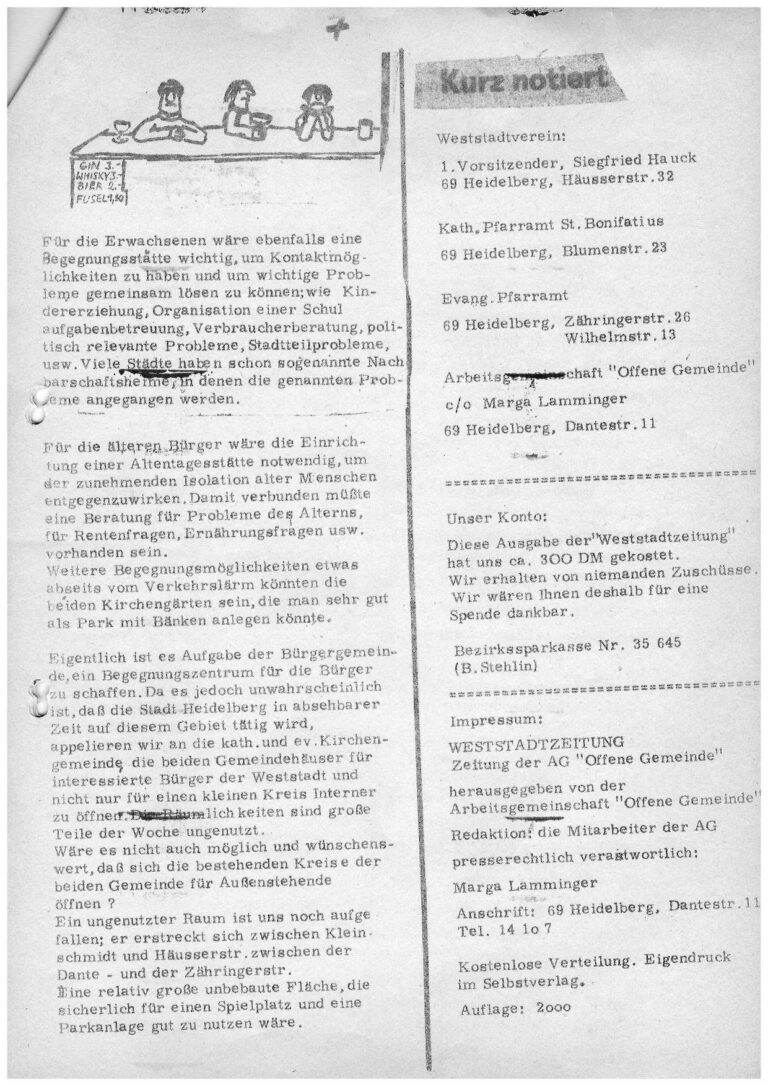Zur Einordnung des folgenden Textes in den Gesamtzusammenhang
diesem Link folgen.
Zum nächsten Kapitel der Chronologie gehts hier lang.
1973: "Für diese Bank habe ich mitgesoffen"

Engagement im Stadtteil:
Der seit 1972 von der Gemeinde St. Bonifatius unabhängige katholische Jugendverband BDKJ engagierte sich beim „Weststadtfest“ des Stadtteilverein, das 1973 zum ersten Mal stattfand.
Allerdings wollte der Jugendverband die Bierzeltkultur nach mehreren Jahren durch eigene kulturelle Ausdrucksformen verändern. Was seitens des Stadtteilvereins aber nicht so gerne gesehen wurde.
Ende der 70 er Jahre fand das Engagement des BDKJ St. Bonifatius beim Stadtteilfest sein Ende. Die Ideen wirkten aber fort und führten 1983 zum Start des SOMMERSPEKTAKELS.
1973-1980:
Zusammenarbeit des BDKJ mit dem Stadtteilverein beim WESTSTADTFEST – aber auch Dissens über die Form des Festes
1973
Erstes Weststadtfest des Stadtteilvereins:
„Für diese Bank habe ich mitgesoffen“
Stadtteilverein Heidelberg-West, fest in der Hand der konservativen bis „rechtslastigen“ CDU in der Weststadt, lud 1973, anlässlich des 80 jährigen Jubiläums des Stadtteilvereins, zum „Ersten Weststadtfest“ ein.
Ein großer Erfolg, wie man der örtlichen Presse entnehmen kann. Bierzelt, Sauerkraut mit Knöchele, Blasmusik, Bier floss in Strömen, CDU-Honoratioren gaben sich die Ehre.
Der eine oder andere musste angeblich spätabends mit dem Notarztwagen zur Ausnüchterung in die nahe gelegene katholische Klinik gebracht werden. Die Aufforderung der Festveranstalter ist anscheinend zu wörtlich genommen worden: „Saufen für neue Bänke auf dem Wilhelmsplatz“ (siehe RNZ, unten).
Solche Anekdoten erzählte man sich in der anderen Szenerie der Weststadt – bei den eher jüngeren Weststädter*innen, organisiert im rebellierenden katholischen Jugendverband BDKJ/KJG. Ob sie tatsächlich stimmten, konnte nicht mit letzter Sicherheit bewiesen werden. Sie passten aber ins weltanschauliche Bild, das sich die jungen „Rebell*Innen“ über die konservativen Weststadthonoratioren machten.
Diese junge Szene hatte wenig mit diesem kulturellen und noch weniger mit dem konservativen politischen Milieu zu tun. Obwohl – bzw. weil- sie als „Weststadtkinder und Jugendliche“ in diesem Milieu groß und sozialisiert wurden.
Sie gehören aber zwei unterschiedlichen Generationen an: Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration. In den 70er und 80 er Jahre trafen in der Weststadt (natürlich nicht nur dort…) diese beiden „Generationen“ in ihrem Engagement im Stadtteil aufeinander. Ihre politischen und kulturellen Ausdrucksformen hätten nicht gegensätzlicher sein können.
Trotzdem stellte der „rebellische“ BDKJ bis Ende der 70er Jahre zuverlässig die Bedienung beim konservativen Stadtteilvereinsfest.